von David Zweistein
Seit Jahrhunderten debattiert die westliche Welt immer wieder den Begriff des »freien Willens«. Doch bis zum heutigem Tage ist keine Einigung zwischen den beiden Position – es gibt ihn oder es gibt ihn nicht - in Sicht. Im Gegenteil: Die Meinungen hinsichtlich der Frage, ob der Mensch über eine »Willensfreiheit« verfügt, könnten unterschiedlicher nicht sein. Daher ist eine grundsätzliche Betrachtung der Frage, ob und inwieweit ein »freier Wille« existieren kann, immer noch von Bedeutung.
In der Debatte wird üblicherweise zunächst der Versuch unternommen, den Begriff »Freiheit« zu definieren. Beispielsweise unterscheidet Robert Kane (Jahrgang 1938, University of Texas, Austin, Texas, USA) in seinem Werk A Contemporary Introduction to Free Will zwischen „oberflächlichen" und „tiefergehenden Formen" der »Freiheit«. Sein Vorhaben, zu einer allgemein anerkannten Definition der »Willensfreiheit« zu gelangen, geht jedoch in der Debatte um die Frage nach der Vereinbarkeit (Kompatibilität) von »Determinismus« und »Willensfreiheit» unter. Er untersucht leider nicht die Berechtigung der These des »Determinismus« per se, sondern verteidigt seine Idee, dass alles determiniert sei, anhand alltäglicher Erfahrungen. Erkenntnisse, besonders der Quantenphysik, ignoriert oder relativiert er mit der Behauptung, dass Aussagen über die Grundbausteine des Universums auf die „alltägliche Welt" nicht übertragbar seien – als würde der Makrokosmos anders sein als der Mikrokosmos. Bei genauerer Betrachtung der modernen Physik bleibt einem jedoch nichts anderes übrig, als den »Determinismus« als falsches Konzept aufzugeben.
Einmal befreit vom Phantomschmerz des »Determinismus« bekommt die Debatte über den »freien Willen« eine neue Dynamik und Ausrichtung: Die Uneinigkeit der philosophischen Disputanten in der Auseinandersetzung ist meines Erachtens darin begründet, dass eine gesuchte, objektive und generell anerkannte Antwort nicht existieren kann, weil »Willensfreiheit« schlichtweg eine Definitionsfrage ist. Definitionen werden stets in Abhängigkeit von Interessen und Absichten aufgestellt, sodass sie schon vom ersten Moment ihrer Existenz an abhängig von anderem sind: Ist es mein Interesse, dem Menschen »Willensfreiheit« zuzusprechen, wähle ich eine dementsprechende Definition. Spreche ich dem Menschen andererseits einen »freien Willen« ab, entspringt dies ebenfalls einem spezifischen, meist autoritären Interesse.
Insofern ist die Debatte über den »freien Willen« im Wesentlichen von Interessen und damit einhergehenden Gefühlen sowie dahinter stehenden Weltbildern (Paradigmen) der Disputanten abhängig. Die Debatte ist – wie jede andere auch - subjektiv und für grundlegende, philosophische Belange nur insofern relevant, als wir damit ergründen können, inwieweit und bis zu welchem Grad der Mensch »Freiheit« überhaupt erleben kann. Nur im Rahmen psychologischer Betrachtungen über die Weltbilder der Diskutanten und der Gesellschaften, in denen diese leben, ist die Idee des »freien Willen« untersuchenswert.
Dennoch möchte ich der philosophischen Tradition folgend diesen Essay mit der fundamentalen Frage einleiten: „Besitzen wir Menschen einen »freien Willen« oder nicht?" Beginnen wir, die in Frage stehenden Begriffe zu beleuchten:
Das Wollen
Hannah Arendt konstatierte in ihrer Untersuchung über Das Wollen, dass „Aristoteles die Existenz des Willens nicht zu erkennen brauchte, denn bei den Griechen fehlte überhaupt ein Wort für das, was wir »Triebfeder des Handelns« nennen. [...] Das von Aristoteles neu geprägte Wort, das unserer Vorstellung von einem Geisteszustand, der dem Handeln vorausgehen muss, näherkommt, ist »proairesis«: Die »Wahl zwischen zwei Möglichkeiten oder Präferenzen«, aufgrund derer man eine Handlung anstelle einer anderen wählt."[2] Dementsprechend kann der Begriff »Wille« aus dem alltäglichem Gebrauch wie folgt hergeleitet werden:
Ich will etwas, wenn ich mir
(1) einerseits meiner möglichen Handlung und meiner Umgebung bewusst bin und darüber hinaus
(2) mit meiner möglichen Handlung bewusst einen Zweck verfolge.
Wir können sagen, jemand wolle etwas - zum Beispiel einen Schal stehlen - wenn diese Person sich (1) darüber bewusst ist, was er oder sie tut, und weiß, dass der Schal nicht sein oder ihr Eigentum ist. Darüber hinaus (2) muss die Person die Absicht haben, diesen Schal zu entwenden - den Schal also nicht beispielsweise aus Versehen mitnehmen, was ja auch eine potenzielle Erklärung sein könnte.
Die Freiheit
Mit Blick auf den Begriff »Freiheit«, können wir mit Hannah Arendt feststellen, dass „der Prüfstein einer freien Handlung – von der Entscheidung, morgens aufzustehen oder nachmittags spazieren zu gehen, bis hin zu den höchsten Entschlüssen, mit denen wir uns für die Zukunft binden – immer das Wissen ist, dass man eine Handlung auch hätte unterlassen können."[3]
Folglich bin ich erst dann »frei« etwas zu tun, wenn ich in der Lage bin, zwischen A und B zu entscheiden. Daraus folgt, dass »Freiheit« ein Vermögen ist, etwas zu tun oder auch zu unterlassen. Wenn ich »frei« bin, A und nicht B zu tun, besitze ich das Vermögen »Freiheit«.
Im Kontext zu dem Vermögen eines »Wollens« führt dies zu der Aussage, dass ich dann aus »freiem Wille« handle, wenn ich das Vermögen habe, bewusst und mit einer Absicht zu handeln oder es auch sein zu lassen.
Der Determinismus
An diesem Punkt kommen in der philosophischen Debatte meist die Konzepte »Determinismus« und »Zufall« ins Spiel. »Determinismus« definiert Robert Kane wie folgt:
„An event is determined, when there are conditions obtaining earlier whose occurrence is a sufficient condition for the occurrence of the event. In other words, it must be the case that, if these earlier determining conditions obtain, then the determined event will occur."[4]
In einem deterministischem System ist jedes Ereignis das Ergebnis einer Anzahl von klar definierten Faktoren, die das Ereignis notwendig auslösen. Zwei Prämissen werden damit aufgestellt:
(1) Jedes Ereignis hat eine Ursache.
(2) Die Ursache besteht aus wohldefinierten, eindeutigen Faktoren, die hinreichende und notwendige – insofern »eineindeutige« – Bedingungen für das Ereignis darstellen.
Wenn eine Anzahl von Faktoren Fi,...,Fn hinreichend für eine Konklusion K sind, bedeutet das, dass aus den Faktoren ein spezifisches Ergebnis folgt. In Gestalt einer Formel geschrieben, hieße das: F1,...,Fn ==>K. Die Faktoren zusammengenommen implizieren: Wenn die Faktoren alle wahr sind, muss die Konklusion gleichfalls als wahr eintreten.
Sind Faktoren für eine Konklusion notwendig, bedeutet das K ==> Fi,...,Fn: Wenn die Konklusion wahr ist, müssen alle Faktoren ebenfalls wahr sein. Daraus wiederum folgt der Logik entsprechend Fi,..., Fn <==> K, ergo: Die Faktoren zusammengenommen sind äquivalent zu der Konklusion; beide haben den selben Wahrheitsgehalt: Gilt die Konklusion, dann gelten die Faktoren; gelten die Faktoren, dann entsteht die Konklusion.
Hinsichtlich eines deterministischen Universums existieren somit zwei notwendige Bedingungen, die erfüllt sein müssen: Ein Ereignis hat (1) eine Ursache in Form von einer Anzahl von Faktoren, die (2) zusammengenommen das Ereignis »eineindeutig« auslösen, das heißt, mit dem Ereignis äquivalent sind.
Das Ursache-Prinzip
Oberflächlich betrachtet wird die These einer »deterministischen Welt« aufgrund alltäglicher Lebenserfahrungen bestätigt. Denn wir beobachten meist, dass eine Veränderung »nur« dann geschieht, wenn jemand oder etwas sie verursacht. Deshalb besitzen wir Menschen auch ein angeborenes Streben, nach »Ursachen« zu suchen.
Eine Metapher für dieses fast schon reflexartige Verhalten skizziert folgende Situation: Man stelle sich vor, jemand rollt einen Ball in einen Raum, in dem ein Kind und ein Hund sitzen. Was passiert, wie reagiert der Hund und wie das Kind? Der Hund wird »natürlicherweise« dem Ball nachjagen und damit zu spielen beginnen. Das Kind hingegen wird mit großer Wahrscheinlichkeit wenigstens einen Blick über die Schulter werfen, um zu sehen, woher der Ball kam. Es wird wissen wollen, wer den Ball in den Raum gerollt hat; abstrakt gesprochen: Das Kind sucht nach einer »Ursache«.
Gegen die These, dass alles eine »Ursache« hat, kann man Situationen vortragen, in denen etwas komplett Unerwartetes passiert und wir selbst nach intensiven Forschungen keinen Grund für das Ereignis finden können. Beispielsweise wird es meist keine erkennbare »Ursache« dafür geben, dass ich einen lang verschollenen Sandkasten-Freund gerade an meinem Geburtstag an unserem altem Spielplatz wieder traf. Bedeutet dies, dass es keine »Ursache« gibt?
Im Englischen werden solche Situationen zutreffend als „coincidently" umschrieben, was die Situation im ursprünglichem Sinne des Wortes beschreibt, doch wird das Adverb oft im Sinne von »zufälligerweise« übersetzt. Die richtige Übersetzung für »koinzident« bedeutet aber »zusammenfallend« und bringt zum Ausdruck, dass mehrere Ereignisse gleichzeitig passieren. »Koinzidenz« ist nur eine Feststellung des Offensichtlichen. Aber trotz der »zusammenfallenden« Ereignisse kann bei mir der Eindruck hängen bleiben, ich hätte meinen Kindheitsfreund rein »zufällig« getroffen. Also doch ohne »Ursache«?
Der Zufall
Hier nun ruft Robert Kane den »Zufall« als Spieler auf den Plan. Als Beispiel des »Zufalls« führt er den Zerfall radioaktiver Isotope an, als gäbe es keine »Ursache« dafür. Wie beim Sandkasten-Freund liegt allerdings ein grundlegender Fehlschluss vor: Wenn Physiker oder Physikerinnen von einem »random radioactive decay« (dt.: zufälliger radioaktiver Zerfall) sprechen, bedeutet das nichts weiter, als dass der Zeitpunkt des Zerfalls unvorhersehbar (indefinit) ist. Es existiert einfach keine Information im System, die den Zeitpunkt des Zerfalls so definiert, dass wir ihn vorhersehen könnten. Davon, dass der Zerfall keine »Ursache« hat, ist gar nicht die Rede. Vielmehr wird dies von Nichtphysikern wie Robert Kane in den Vorgang hineininterpretiert. Die »Ursache« für den Zerfall ist in der Physik eindeutig: Das Isotop ist instabil, sucht einen energetisch stabileren Zustand und zerfällt deshalb in zwei leichtere Isotope. Nur der Zeitpunkt des Zerfalls lässt sich nicht vorherbestimmen.
Im täglichen Leben existieren in der Regel hinreichende Informationen in Systemen, sodass das Treffen mit meinem Kindheitsfreund nicht »zufällig« sein kann. »Zufällig« bedeutet nur, dass ich die »Ursachen« nicht kenne, aber es bedeutet nicht, dass es keine »Ursache« gibt. Deshalb können wir festhalten: Die Frage, ob alles eine »Ursache« hat, kann a priori nicht abschließend beantwortet werden, aber aufgrund unserer alltäglichen Erfahrungen können wir mit gutem Gewissen auch in Zukunft erst einmal nach der nächsten »Ursache« suchen. Schließlich ist Wissenschaft nichts anderes als Ursachenforschung und ich wäre nicht der Erste, der behauptet, dass das Streben nach Wissen ein Sinn des Lebens ist. Damit ist die erste Prämisse des Determinismus, dass alles eine »Ursache« hat, gesichert.
Die Eineindeutigkeit
Es lässt sich schon erahnen, dass die zweite Prämisse des »Determinismus«, dass das Ereignis und die zusammengenommenen Faktoren - die die »Ursache« ausmachen - äquivalent und eineindeutig sind, nicht zu halten ist. Äquivalent bedeutet: Genau dann, wenn Fi,..., Fn gelten, tritt K ein. Ein Ereignis wird also »eineindeutig« von einer »Ursache« bestimmt. Um zu belegen, dass diese »Eineindeutigkeit« nicht immer gegeben ist, hilft eine Exkursion in die Physik:
Bereits 1899 formulierte Max Planck (1858 – 1947) die Quantenhypothese und befand, dass Energie und Materie nicht beliebige Energiemengen, sondern nur diskrete Energiepakete austauschen können, die sogenannten Quanten. Licht besteht dieser Theorie zu Folge aus Energiepaketen, die Lichtquanten oder Photonen genannt werden. Im Laufe weiterer Untersuchungen ergab sich allerdings ein Problem: Einige Charakteristika des Lichts konnten nur anhand von Lichtwellen beschrieben werden, andere nur unter der Annahme eines Lichtpartikels.
Folglich wurde die Idee eines Wellen-Teilchen-Dualismus erdacht, welches Licht sowohl als Welle und wie auch als Teilchen auffasst. Auf dieser Basis entwickelten Erwin Schrödinger (1887 – 1961) und Werner Heisenberg (1901 – 1976) mit unterschiedlichen mathematischen Methoden die Quantenmechanik als ein mathematisches Modell zur Beschreibung und Erklärung dieses Dualismus. Die Grundidee dieser neuen Mechanik sind Wahrscheinlichkeitsaussagen: Während in der Newton'schen Mechanik jede physikalische Größe, die sogenannten »Observable«, einen eindeutigen Zahlenwert für zum Beispiel den Ort und den Impuls (Richtung) besitzen, sind solche Aussagen für Lichtquanten nicht möglich, was anhand verschiedener Experimente bestätigt wird:
a) Im sogenannten Licht-Streuungs-Experiment wird Licht durch einen Spalt geschickt. Wenn man versucht, den Spalt immer enger zu machen, um den Ort der Photonen genauer zu bestimmen, tritt irgendwann ein sonderbarer Effekt auf: Das Licht wird ab einer gewissen Breite des Spalts nicht mehr genauer auf einen Punkt an einer Wand hinter dem Spalt projiziert, sondern stattdessen stark gestreut. Ähnlich verhalten sich Wasser- oder Schallwellen, wenn sie an Ecken stoßen. Die Wellen beugen sich um die Ecken und streuen sich im dahinter liegenden Raum - weshalb wir »um die Ecke hören« können, selbst wenn keine anderen Flächen vorhanden sind, an denen der Schall reflektiert werden könnte.
Werner Heisenberg interpretierte dieses Phänomen in seiner berühmten »Unschärferelation«, die besagt, dass der Ort und der Impuls (Richtung) eines Photons nicht gleichzeitig genau bestimmbar sind. Das liegt nicht an einer Ungenauigkeit der Messinstrumente, sondern schlicht und einfach daran, dass keine Informationen im oder am Photon vorhanden sind, um seinen Ort und Impuls gleichzeitig genau bestimmen zu können. Wir können lediglich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit feststellen, wie sich Photonen in einem System verhalten – weshalb kein System in unserer Welt »eineindeutig« bestimmt, folglich auch nicht determiniert ist.
b) Die »Nicht-Determiniertheit« wird auch in einem sogenannten Doppel-Spalt-Experiment bestätigt: Hierbei werden Photonen (oder andere subatomare Partikel) auf einen Spalt geschossen, der allerdings genügend breit ist, damit keine große Streuung entsteht. Auf der Wand hinter dem Spalt ist ein Muster zu erkennen, welches die Partikel erzeugen, die durch den Spalt treten konnten – sichtbar als heller (»getroffener«) Bereich in der Form des Spalts auf der Wand. Bringt man jedoch einen zweiten Spalt direkt neben dem ersten an und wiederholt das Experiment, ist auf der Wand kein Bild des Spalts mehr zu sehen. Vielmehr erkennen wir das Interferenzmuster einer Welle - helle, aber auch dunkle Flecken - die anzeigen, dass eine Welle sich durch destruktive Interferenz selbst auslöscht. Pho¬tonen verhalten sich also durch das Hinzufügen eines weiteren Spalts wie eine Welle und nicht mehr wie zuvor als Partikel.
c) Damit aber nicht genug der Verwirrung. Will man erkunden, durch welchen der beiden Spalte das Photon bei dem Wellen-Interferenzmuster fliegt und stellt dazu einen Sensor an einem der Spalte auf, passiert etwas noch Merkwürdigeres: Die Photonen verhalten sich jetzt wieder wie Partikel und man sieht zwei helle Balken anstatt eines Interferenzmusters. Das bedeutet, dass der Akt des »Beobachtens« das System verändert hat. Der Experimentator ist also kein »objektiver« Außenstehender, sondern beeinflussender Teil des Experiments.
Damit zeigt die moderne Physik, dass ein physikalisches System nicht aus genau definierten Informationen besteht, welche im klassischen Sinne mechanisch wirken, sondern dass grundsätzlich alle Systeme – die zumindest auf unserer Erde den Gesetzen der Physik folgen - »nicht-determiniert« sind. Sie sind zu dem Zeitpunkt, an dem das Ereignis beobachtet wird, entsprechend der »Unschärferelation« nie »eineindeutig« bestimmbar.
Zu den Experimenten ist anzumerken, dass die Existenz einer »Ursache« nicht widerlegt wird. Sie zeigen jedoch, dass Faktoren, welche ein Ereignis »eineindeutig« bestimmen müssten, um eine Vorherbestimmung zu garantieren, per se nicht existieren, sondern erst im Moment einer Beobachtung - und selbst da nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit - auftauchen. Selbst die erste Prämisse des »Determinismus« – dass es immer eine »Ursache« gibt – ist letztlich fraglich. Doch ist sie »erfahrungsgemäß« als sinnvoll anzunehmen. Klar ist aber: Die zweite Prämisse des Determinismus – die »Eineindeutigkeit« zwischen »Ursache« und Wirkung - wird durch die Quantenmechanik widerlegt.
Aus den vorgetragenen Gedanken können wir nun im Hinblick auf unsere Fragestellung folgende Konsequenzen ziehen:
- Der »freie Wille« ist gegeben, wenn ich mit einer mir bewussten Absicht entscheiden kann, etwas zu tun oder zu lassen.
- Der »Determinismus« ist widerlegt, da nur seine erste Prämisse bestätigt werden kann, während die zweite Prämisse eindeutig ungültig ist.
Die Unmöglichkeit absoluter Freiheit
Das von Robert Kane angeführte »Konsequenz-Argument« nimmt an, dass der »Determinismus« in beiden Prämissen wahr ist, woraus er schlussfolgerte, dass der »freie Wille« nicht existiert. Die Validität dieses Arguments ist nach den oben aufgeführten Ergebnissen der modernen Physik hinfällig, weil der »Determinismus« sich als falsch erwiesen hat.
Dennoch könnte man nunmehr einwenden, dass die Annahme, alles habe eine »Ursache«, welche weiterhin für »wahr« erachtet wird, inkompatibel sei zu der Idee des »freien Willens«. Man könnte wie folgt argumentieren: Angenommen ich wähle A und nicht B, dann müsste es laut der ersten Prämisse dafür eine »Ursache« geben. Man könnte aber meinen, damit ich »frei« A wählen kann, müsste ich die vollständige Kontrolle über die Wahl haben und dementsprechend auch über die »Ursache« meiner Existenz.
Tatsächlich aber bin ich Teil einer unüberschaubaren Kausalkette, deren Anfang ich nicht kontrollieren und ich folglich auch nie »absolut frei« etwas wählen kann. Um also einen »absolut freien Willen« zu besitzen, müsste jemand die »Ursachen seiner selbst« sein. Das wäre aber gleichbedeutend mit der Aussage, dass jemand »aus sich selbst heraus« existieren würde.
Nun ist aber offensichtlich, dass niemand die »Ursache seiner Existenz« ist und damit auch »nicht aus sich selbst heraus existiert«. Die Annahme einer »inhärenten Existenz« widerspricht zudem unserem Verständnis des menschlichen Miteinander, bei dem der individuelle Mensch nur in der Gesellschaft anderer leben kann und damit in »Abhängigkeit von anderem« existiert.
Die relative Freiheit
Stellt sich abschließend die Frage, ob es eine andere Art des »freien Willens« geben kann, obwohl ich nicht die letzten Ursache meiner Existenz kontrolliere? An diesem Punkt kommt die eingangs genannte Subjektivität ins Spiel, die sich aus den individuellen Weltbildern und Gefühlen ergibt. Definiere ich den Begriff »freier Willen« als das Vermögen, letztendliche »Ursachen« kontrollieren und auswählen zu können, dann besitzt kein Mensch einen »freien Willen«, weil niemand aus sich selbst heraus existiert.
Definiere ich aber dieses Vermögen als die Fähigkeit, zwischen A und B zu einem gegebenen Zeitpunkt und unter aktuellen Umständen absichtlich und bewusst zu entscheiden, dann besitzt jeder Mensch einen »relativ freien Willen«, wobei der »Grad« dieser Freiheit von vielen Faktoren abhängt, da Menschen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen und mit verschiedenen Geisteszuständen leben.
Hieraus aber folgt: Welche Definition des »freien Willens« angewendet werden soll, ist ein Frage der Weltbilder (Paradigmen), Lebenserfahrungen und resultierender Gefühle. Wäre es für mich sinnvoll, jedem Menschen einen »freien Willen« abzusprechen, um beispielsweise über andere zu herrschen, würde ich die Definition der »absoluten Freiheit« wählen. Gehe ich hingegen von einer »relativen Freiheit« des Menschen aus, weil ich erkenne, dass wir alle »gleichwertige Abhängige« sind und ich jeden Menschen als Akteur seines oder ihres »relativen Willens« ansehe, folge ich einem anderen Lebensbild. Insofern hat die Debatte über den »freien Willen« erst im Kontext der Interessen und der Psychologie eine Bedeutung, weil sie die Frage nach dem Geisteszustand eines Menschen ist.
Fest steht: Wir existieren nur in »Abhängigkeit« von der Welt um uns herum; unsere Welt ist nicht »determiniert« und durch einen »relativ freien Willen« formbar.

David Zweistein (Jahrgang 1996) studiert Mathematik und Philosophie
an der Georg-August-Universität Göttingen;
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
[1] Anmerkung zum Titelbild: Eine Taylor-Reihe [engl. Series] ist ein Hilfsmittel der Physik zur Vereinfachung komplizierter mathematischer Funktionen durch Annäherung. Würde man eine hypothetische »Weltformel« in einer solchen Weise ausdrücken, würde – da unser Universum nicht determiniert ist – in der Formel immer ein Fehlerterm [Unbestimmtheit] existieren, da die Welt nicht bis ins Unendliche fortgeführt werden kann.
[2] Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes, Teil 2: Das Wollen, S. 255
[3] Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes, Teil 2: Das Wollen, S. 265
[4] Robert Kane, A Contemporary Introduction to the Free Will, S. 5; deutsch: „Ein Ereigniss ist »determiniert«, wenn die vorausgehenden Zustände für das Auftreten dieses Ereignisses hinreichend sind. Mit anderen Worten, es muss der Fall sein, dass, wenn diese vorausgehenden Zustände gelten, das determinierte Ereigniss eintritt.“
Weiterführende Literaturempfehlungen
- Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes, Piper Verlag, 1998
- Werner Heisenberg, Quantentheorie und Philosophie, Reclam, 1979
- Robert Kane, A Contemporary Introduction to Free Will, Oxford University Press, 2005
- Polkinghorne, John, Quantentheorie, Reclam, 2002
- Norman Sieroka, Philosophie der Physik, C.H.Beck Wissen, 2014
- Simon Singh, Big Bang, dtv, 2004
- Anton Zeilinger, Einsteins Schleier - Die neue Welt der Quantenphysik, Wilhelm Goldmann Verlag, 2005
Hier zum kostenlosen Download des Artikels


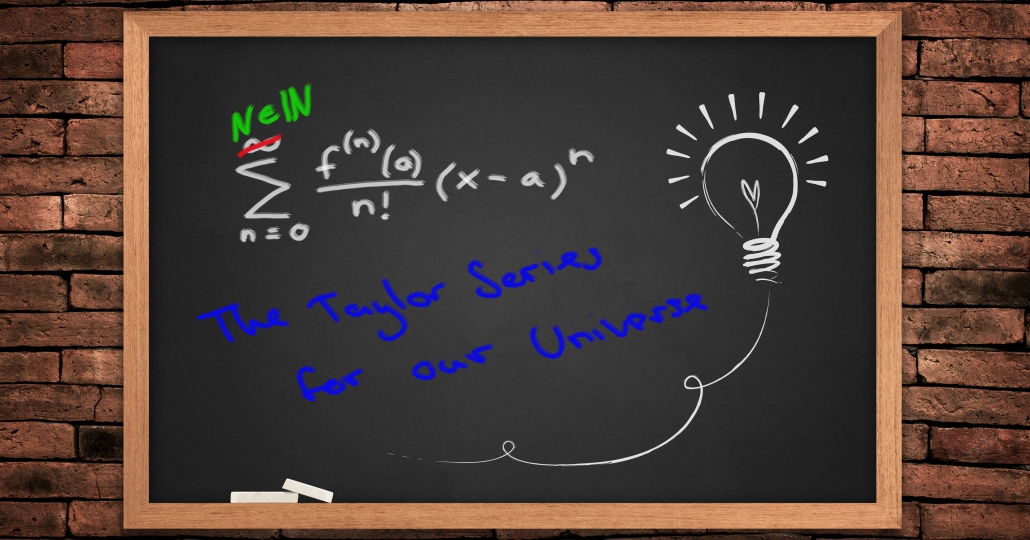
Kommentare powered by CComment